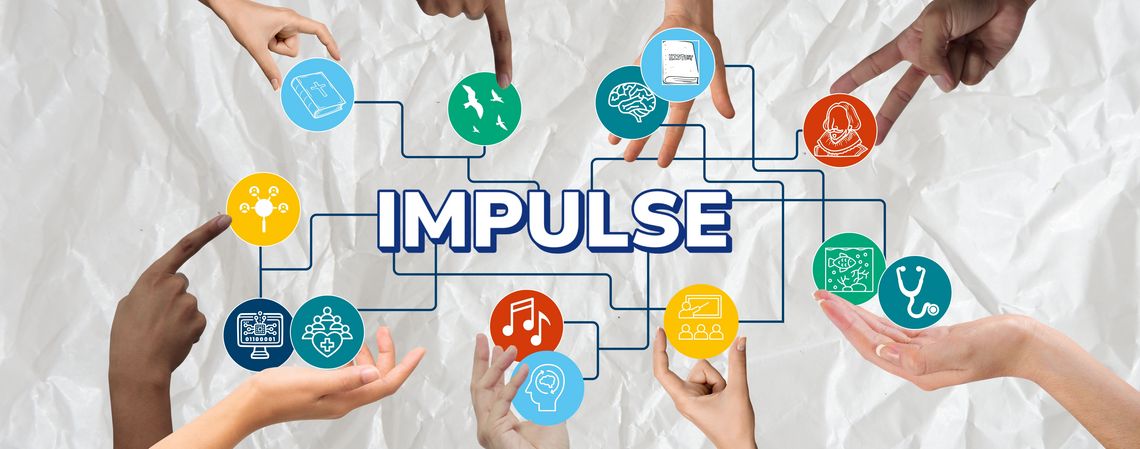Interdisziplinarität setzt Impulse
Interdisziplinarität setzt Impulse
Ungewöhnliche Forschungsansätze, in denen sich Disziplinen begegnen, die auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten haben – dieser rote Faden zieht sich durch die neuen Impulsgruppen, die zum Wintersemester ihre Arbeit aufnehmen.
Die Diversität in der ländlichen Gesundheitsversorgung fördern, eine Künstliche Intelligenz für den Musikunterricht entwickeln oder mithilfe der Bibel und moderner Tiernavigationsforschung die Orientierungsfähigkeiten von Menschen in der Antike erforschen – die Themen, mit denen die Impulsgruppen überzeugen konnten, sind ähnlich vielfältig wie die Teams, die sie erarbeitet haben. Forschende aus jeweils bis zu drei Fakultäten werden die kreativen Projekte jetzt umzusetzen.
„Wir waren wirklich begeistert von den insgesamt 20 erstklassigen Bewerbungen, die uns einmal mehr nicht nur gezeigt haben, wie visionär und innovativ unsere Forschenden denken, sondern auch, dass der Leitgedanke unseres Antrags, neue Personenkonstellationen miteinander ins Gespräch zu bringen, jetzt schon gefruchtet hat. Der interdisziplinäre Dialog gehört an unserer Universität zum wissenschaftlichen Selbstverständnis“, sagt Prof. Dr. Ralf Grüttemeier, Vizepräsident für Forschung und Transfer.
Hintergrund
Die Auswahl der Projekte, die ab dem Wintersemester als Impulsgruppe gefördert werden, erfolgte auf Empfehlung einer Beratungsgruppe. Prof. Dr. Thony Visser von der Rijksuniversiteit Groningen (Niederlande), Prof. Dr. Simone Scherger von der Universität Bremen und Prof. Dr. Dr. Reto Weiler haben alle Anträge begutachtet und dem Präsidium anschließend eine Auswahl vorgeschlagen. Grüttemeier hatte diese Beratungsgruppe als stimmloser Vorsitzender geleitet.
Die neuen Impulsgruppen sind Teil des „Programms für Exzellenz“, mit dem die Universität Anfang des Jahres das Niedersächsische Wissenschaftsministerium und die VolkswagenStiftung überzeugen konnte. Sie fördern das Programm der Universität in der Förderlinie „Potenziale strategisch entfalten“ im Rahmen von „zukunft.niedersachsen“ mit insgesamt 22,5 Millionen Euro. Die Impulsgruppen erhalten daraus für vier Jahre Personalmittel (bis zu zwei Vollzeitäquivalente), mit denen sie Promovierende und Postdocs einstellen können, und ein jährliches Sachmittelbudget von 10.000 Euro. Eine Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr ist auf Antrag möglich.
Grobe Oberthemen, zu denen die Forschenden interdisziplinäre Vorhaben einreichen konnten, hatten das „Programm für Exzellenz“ und die anschließende Ausschreibung vorgegeben. So war sichergestellt, dass die vorgeschlagenen Projekte auf die zentralen Ziele des Programms einzahlen: die vielversprechenden Potenzialbereiche in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu stärken und die Interdisziplinarität weiterzuentwickeln – nicht zuletzt dadurch, dass jeweils drei Impulsgruppen unmittelbar mit den naturwissenschaftlich geprägten Exzellenzclustern zusammenarbeiten werden beziehungsweise einen Bezug zur Universitätsmedizin Oldenburg haben.
Die Impulsgruppen im Überblick

Spielerischer Umgang mit Künstlicher Intelligenz
Statt KI nur als Bedrohung oder Lösung zu sehen, geht RECOMPOSE einen dritten Weg: Es zeigt, wie KI funktioniert, wo sie Verzerrungen (Biases) erzeugen kann und wie wir diese erkennen und kritisch hinterfragen können.

Welchen Informationen wir warum vertrauen
In dieser Impulsgruppe untersuchen die beteiligten Forschenden, wie Nutzer*innen im digitalen Umfeld Informationen erhalten, bewerten und verarbeiten, um der Antwort auf die Frage näherzukommen: Welchen Informationen vertrauen wir?

Die soziale Dimension von Hörverlust
Welche Auswirkungen hat Hörverlust auf unser soziales Leben und wie prägen umgekehrt unsere sozialen Netzwerke den Umgang mit Hörverlust? Diesen und verwandten Fragen nähern sich die Forschenden aus einer interdisziplinären Perspektive

Unsichtbare Facetten des Kohlenstoffzyklus
Die Forschenden wollen den Einfluss früher moderner Globalisierung auf den Kohlenstoffkreislauf sowie den Stellenwert „unsichtbarer“ mariner Mikroorganismen in politischen Entscheidungsprozessen sichtbarer machen.

Navigation in der Antike
Waren die Tiere in der Antike mit ihren Wanderungen die Vorläufer moderner Navigationssysteme und haben Menschen den Weg gewiesen? Das untersucht diese Impulsgruppe und bringt dafür unter anderem bibelwissenschaftliche und biologische Perspektiven zusammen.

Risikogeburt und Resilienz
Forschende aus den Bereichen Medizin, Sozialwissenschaften, Sonderpädagogik und Musikpädagogik wollen gemeinsam herausfinden, wie Resilienz bei ehemals Risikogeborenen im Vorschulalter messbar und mit einer musikpädagogischen Intervention beeinflussbar sein könnte.

Personalisierte Medizin
Wie wirken Umwelteinflüsse und genetische Faktoren zusammen - und welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für eine personalisierte Medizin? Um diesen Antworten näher zu kommen, werten die Forschenden große Datenmengen mit selbstlernenden Systemen aus.
mehr

Diversitätssensible Gesundheitsversorgung
Die Forschenden untersuchen, wie es um diversitätssensible Gesundheitsversorgung insbesondere im ländlichen Raum bestellt ist und entwickeln Konzepte für Ansätze, die einen stärkeren Fokus auf individuelle Bedürfnisse legen.