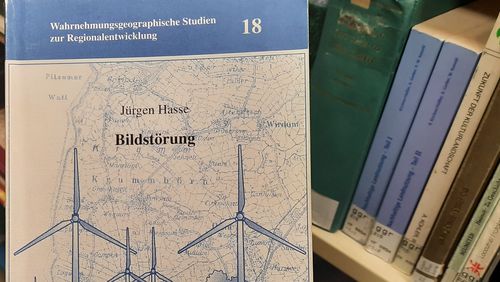Mehr Regen im Winter, dafür Trockenheit im Sommer: Im Nordwesten Niedersachsens wandelt sich das Klima. Wie wir uns an die Veränderungen anpassen können, untersuchen Oldenburger Forschende aus den Umwelt- und Sozialwissenschaften im Projekt WAKOS.
Die Tour über Norderney ist etwa fünf Kilometer lang. Beim „Süßwasserlinsenspaziergang“, den die Oldenburger Doktorandin Lena Thissen gemeinsam mit einer Sozialwissenschaftlerin der Universität Hamburg entwickelt hat, dreht sich alles um einen verborgenen Schatz: den Süßwasservorrat der Nordseeinsel. Los geht die kleine Wanderung beim Wasserwerk in der Inselmitte, anschließend führt der Weg zu einem Förderbrunnen inmitten der kargen Dünenlandschaft und dann in ein mit Bäumen und Seggen bewachsenes „feuchtes Dünental“. Die beiden letzten Stationen liegen am Strand, wo Süßwasser ins Meer fließt und Abbruchkanten an den Dünen die Kräfte der Erosion veranschaulichen. „Die Tour soll die Süßwasserlinse der Insel erlebbar machen – und zeigen, wie der Klimawandel diese wertvolle Ressource gefährdet“, berichtet die Hydrogeologin Prof. Dr. Gudrun Massmann, in deren Arbeitsgruppe Thissen promovierte.
Der Spaziergang, der zukünftig als Führung stattfinden soll, richtet sich an Feriengäste und die Inselbevölkerung. Er ist ein Ergebnis des vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekts WAKOS („Wasser an den Küsten Ostfrieslands“). Seit 2020 befassen sich Forschende von fünf Verbundpartnern unter Leitung des Helmholtz-Zentrums Hereon in Geesthacht mit der Frage, welche Naturgefahren der Küste Ostfrieslands und den vorgelagerten Inseln durch den Klimawandel drohen – und wie sich die Gesellschaft an die neuen Bedingungen anpassen kann. Die zweite Projektphase hat vor rund einem Jahr begonnen. Neben Massmann und ihrem Team der Arbeitsgruppe „Hydrogeologie und Landschaftswasserhaushalt“ sind auch Oldenburger Forschende der Arbeitsgruppe „Ökologische Ökonomie“ um Prof. Dr. Bernd Siebenhüner beteiligt.
Regenwasser speist die Süßwasserlinse
„Der Süßwasserlinsenspaziergang ist eine tolle Sache und zeigt, wie fruchtbar die disziplinübergreifende Zusammenarbeit im Projekt ist“, betont Siebenhüner. Die Tour präsentiert naturwissenschaftliche Ergebnisse so, dass sie jeder versteht: Teilnehmende lernen, dass Süßwasser in den Poren des sandigen Untergrunds der Insel steckt und dort eine bis zu 80 Meter mächtige, linsenförmige Schicht bildet, die durch Regenwasser gespeist wird und quasi auf dem Salzwasser in tieferen Schichten „schwimmt“. Sie erfahren, dass der Trinkwasserbedarf von Bevölkerung und Tourismus aus diesem Reservoir im Inseluntergrund gedeckt wird. „In den feuchten Dünentälern kann man die Oberfläche der Süßwasserlinse sogar sehen. Dort tritt das Grundwasser zutage, weswegen hier eine besondere Flora und Fauna entstehen kann“, erläutert Hydrogeologin Massmann.
Auch die Folgen des Klimawandels können Teilnehmende des Spaziergangs besichtigen: An der letzten Station „Weiße Düne“ befindet sich eine zwei Meter hohe Abbruchkante. „Sturmfluten haben hier in den vergangenen Jahren große Mengen Sand abgetragen“, berichtet Lena Thissen. Der Klimawandel verschärft solche Ereignisse: Der Meeresspiegel ist bei Norderney in den vergangenen hundert Jahren um rund 16 Zentimeter angestiegen, bis Ende dieses Jahrhunderts wird er möglicherweise um bis zu 80 weitere Zentimeter anwachsen. Als Folge treten extreme Wasserstände häufiger auf. Das wirkt sich auch auf die Süßwasserlinse aus, erklärt Thissen: „Wenn die Dünen seeseitig erodieren, schrumpft die Fläche, unter der sich Süßwasser ausbreiten kann, und somit nimmt auch das Trinkwasservolumen ab.“
Wie sich die Linse in Zukunft entwickelt, hat der Doktorand Patrick Hähnel aus Massmanns Team mit numerischen Modellrechnungen ermittelt. Demnach wird der Süßwasservorrat bis Ende des Jahrhunderts je nach Klimaszenario um zehn bis 15 Prozent schrumpfen. „Die Berechnungen zeigen zudem, dass mit dem Meeresspiegel auch der Grundwasserspiegel ansteigt“, erläutert Massmann. Das bedeutet, dass in Zukunft nicht nur einige Dünentäler, sondern auch tieferliegende Bereiche der Stadt und der Flughafen auf Norderney im Winter regelmäßig unter Wasser stehen könnten. „Der Fokus unserer Modellierungen lag eigentlich auf dem Problem der Versalzung, aber unsere Ergebnisse zeigen, dass steigende Grundwasserstände im Winter für die Insel eventuell ein größeres Problem darstellen werden“, berichtet die Forscherin.
Die Küstenregion wird vom Klimawandel besonders betroffen sein.
Bernd Siebenhüner
Im Gesamtprojekt stehen neben Norderney auch die Gemeinde Krummhörn und die angrenzende Stadt Emden im Fokus. Im ostfriesischen Binnenland dürften Sturmfluten, Starkregen, Grundwasserversalzung und Dürren in Zukunft ebenfalls für Probleme sorgen. „Die Küstenregion wird vom Klimawandel besonders betroffen sein“, sagt Umweltökonom Siebenhüner. Ein Szenario, das die Forschenden in der ersten Phase von WAKOS als möglichen Extremfall untersucht hatten, trat bereits Weihnachten 2023 ein: Nach ergiebigem Dauerregen im Dezember kam es zusätzlich zu mehreren Sturmfluten. Siele an der Küste und das Sperrwerk der Hunte in Elsfleth blieben geschlossen, die Pumpen konnten wegen der hohen Wasserstände das Binnenland nicht ausreichend entwässern. Als Folge staute sich das Wasser, Flüsse traten über die Ufer und weite Teile von Niedersachsen wurden überschwemmt.
Bei der Frage, wie sich Ostfriesland gegen solche Ereignisse wappnen kann, geht es nicht nur um technische Lösungen, sondern auch um die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft – ob Land, Kommunen, Wasserverbände, Sielachten und andere Beteiligte in der Lage sind, die nötigen Maßnahmen umzusetzen. Siebenhüner und sein Team untersuchen dies im Rahmen von Workshops und Interviews mit lokalen und regionalen Stakeholdern. „Uns interessiert, wie gut die verschiedenen Akteure vernetzt sind, wie eng der Austausch über verschiedene Ebenen ist und wo Herausforderungen oder Konfliktpotentiale bestehen“, berichtet Lara Saalfrank, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt. Eine Erkenntnis des Teams: Die Planungs- und Entscheidungsstrukturen sind in Niedersachsen besonders kleinteilig, etwa in der Regionalplanung und der Binnenentwässerung. Diese historisch gewachsene Struktur erschwert die Klimaanpassung.
Interessen müssen sorgfältig abgewogen werden
Das größte Konfliktpotential sieht das Team in der Festlegung der zukünftigen Landnutzung: Sinnvoll wäre es den hydrogeologischen Modellrechnungen zufolge beispielsweise, zusätzliche Rückhalte- und Polderflächen auszuweisen und Entwässerungsgräben generell weniger tief auszuheben, um Niederschläge länger in der Landschaft zu halten. Das würde nicht nur helfen, Dürren besser zu bewältigen, sondern auch die Grundwasserversalzung durch Meerwasser im Untergrund verlangsamen, so eine Erkenntnis aus dem Vorgängerprojekt SALTSA. Allerdings stehen nasse und wiedervernässte Flächen häufig im Widerspruch zu landwirtschaftlichen Interessen und dem Hochwasserschutz. Eine mögliche Option für Sturmfluten wäre es, Deiche in bestimmten Bereichen – etwa vor Flutpoldern oder Rückhalteräumen – kontrolliert zu öffnen, um Überschwemmungen in anderen Regionen zu begrenzen. Doch welche Flächen kommen dafür in Frage? „All diese Ansätze – von einer angepassten Entwässerung bis hin zu einem flexibleren Küstenschutz – erfordern eine langfristige und vorausschauende Planung, bei der unterschiedliche Interessen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen“, betont Ernst Schäfer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe „Ökologische Ökonomie“.
WAKOS legt Wert darauf, die eigenen Ergebnisse praxisnah für die Projektregion Ostfriesland aufzubereiten. Zudem entsteht eine „Klimaakademie“. Sie soll digitale Weiterbildung ermöglichen, aber auch Vorträge, Veranstaltungen und Schulungen in Präsenz anbieten. Auf Norderney finden bereits im Herbst erste Workshops statt, auf denen die Forschenden Projektergebnisse zur Süßwasserlinse mit den dortigen Verantwortlichen besprechen. „Es ist wichtiger Teil des Projekts, die Schlussfolgerungen unserer Modellierungen für lokale Akteure nutzbar zu machen“, betont Massmann. Für die Forscherin ist klar: „Wir müssen an vielen Stellschrauben drehen, um das Wassermanagement in der Marsch und auf den Inseln zu optimieren und zukunftsfähig zu machen.“