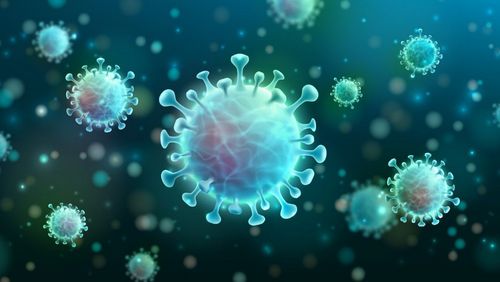Die Justiz sieht sich in vielen Ländern Angriffen von populistischen Parteien ausgesetzt. Der Politikwissenschaftler Philipp Köker erklärt, welche Strategie dahintersteckt – und was sich den Angriffen entgegensetzen lässt.
Warum kritisieren viele populistische Parteien die Justiz so stark?
In liberalen Demokratien spielen Gerichte und insbesondere Verfassungsgerichte eine zentrale Rolle: Sie bewahren die Rechte des Individuums sowie von Minderheiten und schützen damit auch den gesellschaftlichen Pluralismus. Sie überwachen außerdem, dass die Spielregeln der Politik eingehalten werden und dass Gesetze oder andere Beschlüsse der Politik nicht gegen die Verfassung verstoßen. Das ist vor allem Populisten der autoritären Spielart ein Dorn im Auge, denn es bedeutet, dass Gerichte letztlich sogar einem Mehrheitswillen Schranken setzen können. Darin sehen sie eine Untergrabung des vermeintlichen „wahren Volkswillens“, den sie angeblich vertreten und kompromisslos durchzusetzen versuchen. Außerdem sind Populisten oft selbst Normbrecher, die sich über die existierenden Spielregeln bewusst hinwegsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist ein weiterer Grund für sie, Gerichte anzugreifen.
Welches Ziel verfolgen Populisten mit ihren Angriffen auf Gerichte?
Ihr Ziel ist es, dass Menschen das Vertrauen in die Justiz verlieren und diese nicht mehr als legitim anerkennen. Kommt eine populistische Partei an die Macht, fällt es ihr dann leichter, die Justiz der Politik unterzuordnen, ohne großen Widerstand fürchten zu müssen. Aber auch ohne Regierungsbeteiligung ist es für Populisten relevant, die Justiz zu schwächen. In Deutschland beispielsweise kann das Bundesverfassungsgericht politische Parteien verbieten oder ihnen die staatliche Parteienfinanzierung streichen. Wenn jedoch zuvor gezielt Zweifel an der Legitimität von Gerichtsentscheidungen gesät wurden, erschwert dies die Umsetzung der Urteile und erleichtert es Populisten, sich den Gerichten zu widersetzen. Das macht es letztlich schwieriger für die Gerichte, solche Urteile zu fällen.
Welche Strategien nutzen Populisten, um die Justiz in Verruf zu bringen?
Unsere jüngste Studie dazu zeigt, dass Erzählungen von angeblichem Systemversagen oder einer Unterdrückung der Bevölkerung durch eine Elite eine große Rolle spielen – egal, ob Gerichte als Institutionen, Richterinnen und Richter als Personen oder einzelne Urteile angegriffen werden. Nehmen populistische Akteure einzelne Richterinnen oder Richter ins Visier, dann stellen sie diese als verlängerten Arm der Politik beziehungsweise als Erfüllungsgehilfen einer abgehobenen Elite dar, die angeblich gegen das Volk arbeitet. In Deutschland fällt ihnen das vergleichsweise leicht, weil die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht von Bundestag und Bundesrat gewählt werden und teils auch gute Verbindungen zu den Parteien haben. Dabei wird jedoch verschwiegen, dass Richterinnen und Richter primär nach ihrer fachlichen Eignung ausgewählt werden und in der Praxis vollkommen unabhängig handeln. Im Hinblick auf einzelne Urteile versuchen Populisten oft, diese für sich zu instrumentalisieren. Spricht ein Gericht ein Urteil, das nicht im Sinne der Populisten ist, dann sehen sie auch dies als Zeichen dafür, dass hier die Elite gegen das eigene Volk arbeitet. Fällt das Urteil jedoch zum Vorteil der Populisten aus, dann loben diese gern die „rechtschaffenen Richter“, die erkannt hätten, dass man die „wahren Vertreter“ des Volkes gegen die Elite unterstützen müsse. Am Ende bestätigen Urteile also immer das populistische Weltbild – unabhängig davon, wie sie ausgehen.
Wie sieht dieses Weltbild konkret aus?
Der Populismus pflegt als sogenannte dünne Ideologie ein Weltbild, dessen Kernbestandteile eine „Wir gegen die da oben“-Mentalität und ein „Volk gegen Elite“-Narrativ sind. Dass rechtsautoritäre Parteien jedes Urteil so auslegen, wie es in dieses Weltbild passt – und damit durchkommen –, funktioniert auch deshalb, weil die emotionale Bindung ihrer Anhängerinnen und Anhänger deutlich intensiver ist als das, was wir von den Unterstützerinnen und Unterstützern der anderen Parteien kennen. Dies geht so weit, dass vielen Anhängerinnen und Anhängern autoritär-populistischer Parteien selbst eklatante Widersprüche in der Argumentation nicht auffallen. Ein Beispiel: In Deutschland ist von populistischer Seite im Hinblick auf das Bundesverfassungsgericht sowohl der Vorwurf zu hören, dieses sei „regierungshörig“ als auch, es sei zu mächtig und verfolge eine eigene Politik. Doch fallen solche Widersprüche nicht auf, weil es ohnehin weniger um konkrete Politikinhalte als um ein bestimmtes Weltbild geht.
Wie Ihre Forschung zeigt, untergraben populistische Parteien bereits aus der Opposition heraus die Justiz. Welche Wege stehen ihnen dafür offen?
Untrennbar verbunden mit dem Aufstieg des Populismus ganz allgemein sind die sozialen Medien. Sie ermöglichen es autoritären Populisten, ihre Botschaft ungefiltert ans Volk zu bringen – Verschwörungserzählungen und „alternative Fakten“ über die Justiz inklusive. Früher haben Redaktionen in traditionellen Medien Informationen bewertet und auf dieser Basis entschieden, worüber sie berichten. Soziale Medien ermöglichen es populistischen Akteuren, diese traditionellen Medien zu umgehen. Zwar gab es auch früher schon populistische Bewegungen, aber ihr globaler Aufstieg in der jüngeren Vergangenheit und ihr teils erfolgreicher Kampf gegen die Justiz wären ohne die sozialen Medien nicht möglich gewesen.
Gelegentlich klagen populistische Parteien selbst vor hohen Gerichten. Wie passt das zur Strategie, die Justiz zu delegitimieren?
Die Instrumente der Opposition zu nutzen, um den Politikbetrieb zu untergraben, ist Teil der Strategie. Ein Beispiel war die erste Sitzung des Thüringer Landtags im Herbst 2024: Die AfD hat hier die etablierte Norm, dass der Alterspräsident die Sitzung eröffnet und bis zur Wahl eines Landtagspräsidenten der Vorsitzende ist, ausgenutzt, um Chaos zu stiften. Der Alterspräsident von der AfD weigerte sich stundenlang, über einen Antrag abstimmen zu lassen, der es der CDU ermöglicht hätte, einen der ihren als Landtagspräsidenten vorzuschlagen. Daraufhin zog die CDU vor den Thüringer Verfassungsgerichtshof. Einer der Richter dort ist jedoch CDU-Mitglied und dessen Sohn sitzt für die CDU im Landtag – eine Kombination, bei der ein Befangenheitsantrag der AfD durchaus Chancen auf Erfolg gehabt hätte. Die AfD hat sich jedoch bewusst dagegen entschieden: Sie hat das Urteil – das der CDU Recht gab – abgewartet, anschließend gegen die Justiz gewettert und den Richter wegen Rechtsbeugung angezeigt. Aus Sicht von Juristen ein völlig unsinniges Vorgehen, aber es passt perfekt zur Strategie, die Justiz gezielt in Verruf zu bringen.
Wie erfolgreich sind autoritäre Populisten mit ihrer Strategie?
Sehr erfolgreich, wie der Blick ins Ausland zeigt. In den USA ist es dem rechtspopulistischen Flügel der Republikaner mit einer jahrelangen Kampagne gelungen, das Vertrauen in die Justiz massiv zu untergraben. Zwar sind die USA ein Sonderfall, weil dort vor allem der Supreme Court immer schon politisierter war als etwa das deutsche Bundesverfassungsgericht. Trotzdem haben diese ständigen Attacken den amerikanischen Rechtsstaat geschwächt, sodass es heute nur noch wenige US-Gerichte wagen, sich mit der Trump-Regierung anzulegen. Ein anderes Beispiel ist Polen, wo die Regierung der Partei „Recht und Gerechtigkeit (PiS)“ zwischen 2015 und 2023 durch ihre umstrittenen Reformen der Justiz wichtige Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt und das Verfassungsgericht gekapert hat. Auch dort ging diesen Angriffen eine Kampagne voraus, die schon begann, als die Partei noch in der Opposition war. Sie hat damals die Justiz als noch immer von kommunistischen Eliten dominiert dargestellt und behauptet, sie würde nur die Partikularinteressen einiger Minderheiten vertreten. Diese dauernden Attacken haben das öffentliche Vertrauen in die Gerichte stark geschwächt. Als die Partei an die Regierung kam, konnte sie ihre Justizreformen daher schnell umsetzen. Gesellschaftlicher und politischer Widerstand formierte sich erst, als die Tragweite der Reformen deutlich wurde.
Was können die Öffentlichkeit, andere Parteien und die Justiz diesem Vorgehen entgegensetzen?
Zunächst müssen wir alle lernen, populistische Angriffe gegen die Justiz als Teile einer gezielten Strategie zu erkennen. Das war in den vergangenen Jahren in Deutschland noch nicht ausreichend der Fall. Weiterhin sollten die Regierungsverantwortlichen immer wieder die Vorteile einer unabhängigen Justiz hervorheben und deren Urteile konsequent umsetzen – auch dann, wenn sie ihnen missfallen. Auch die Gerichte selbst können mehr tun, etwa indem sie über eine gute Öffentlichkeitsarbeit in verständlicher Sprache Desinformationen entgegenwirken und so wieder mehr Vertrauen schaffen. Eine Schlüsselrolle spielen auch die Medien. Jüngst haben die Geschehnisse rund um die Kandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht gezeigt, was schiefgehen kann. So haben viele Medien anfangs unkritisch über die – inzwischen umfassend widerlegten – Vorwürfe gegen Brosius-Gersdorf berichtet, ohne einzuordnen, wer diese Vorwürfe erhebt und ob diese überhaupt begründet sind. Es gab zum Beispiel nur wenig Nachforschungen dazu, welche Positionen Frau Brosius-Gersdorf tatsächlich zum Thema Abtreibung vertritt und inwiefern es sich hier um eine extreme Position handelt – und zunächst wenig Berichte zur Tatsache, dass sie vielmehr Opfer einer Kampagne rechtspopulistischer Akteure wurde, auf die anscheinend auch einige Politikerinnen und Politiker der Unionsfraktion hereingefallen sind. Dass sich Frau Brosius-Gersdorf schließlich gezwungen sah, ihre Kandidatur aufzugeben, unterstreicht, wie gefährlich Delegitimierungskampagnen für unsere Demokratie sind. Künftig sollten daher auch die Medien früher und direkter Falschinformationen entgegentreten, damit populistische Kräfte mit ihrer Strategie der Delegitimierung der Justiz keinen Erfolg haben.
Interview: Henning Kulbarsch